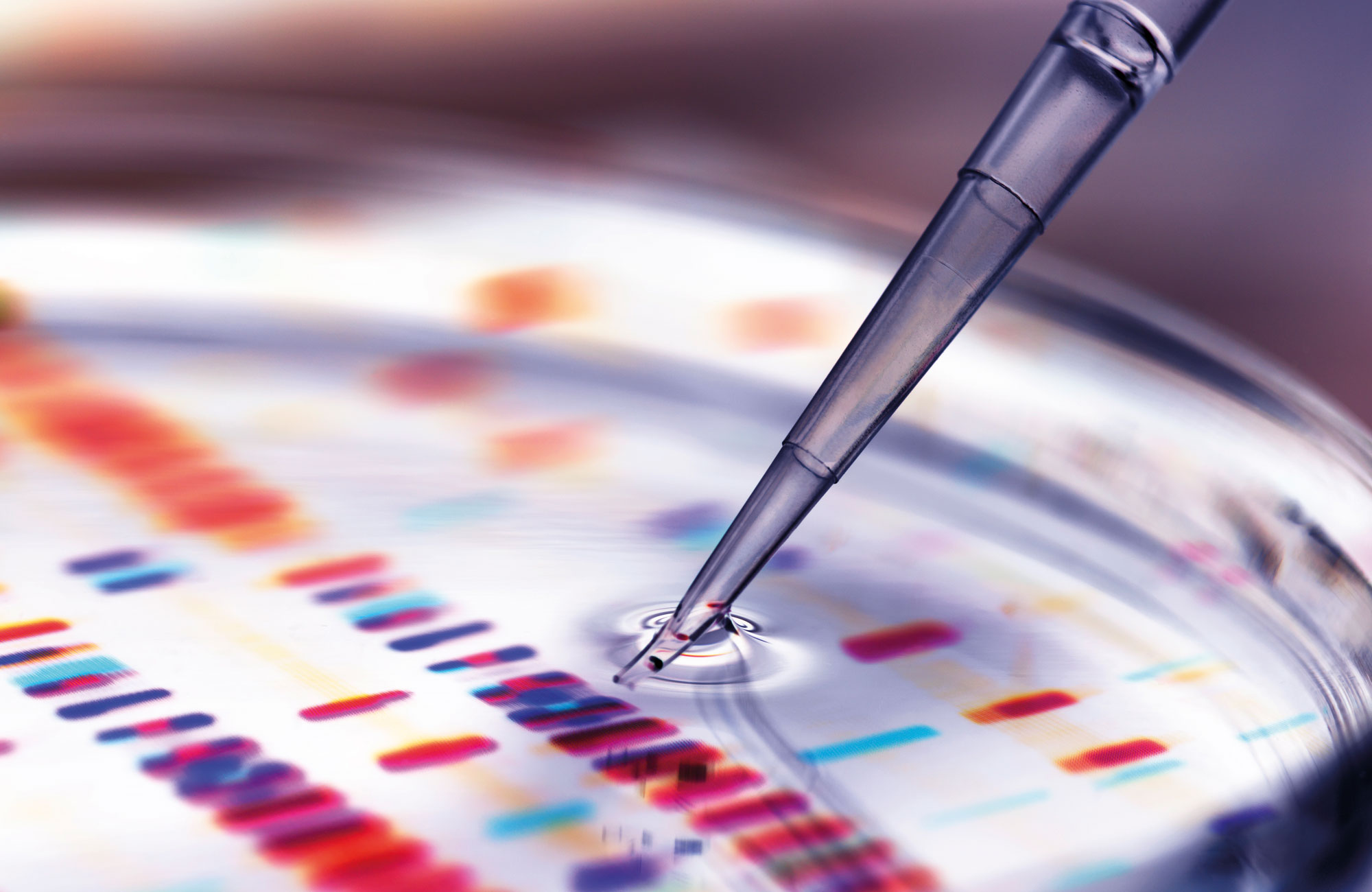Die staatlichen Zügel lockern
Das teure Schweizer Gesundheitssystem ist nicht für Radikallösungen prädestiniert. Allerdings gebe es diverse Ansätze, um in Zukunft die Kosten zu dämpfen, sagt Beatrix Eugster von der Uni St. Gallen.
«Ich bezahle jedem ein Luftschiff, der ein Mittel weiss, wie man einen Franken bezahlen soll, wenn man nur 80 Rappen hat.» Mit diesen Worten brachte der erste Zentralpräsident der heutigen CSS, Josef Bruggmann, bereits 1916 das grosse Dilemma zum Ausdruck, das auch heute noch die ganze Krankenversicherungsbranche prägt: Die Kosten steigen unablässig und damit auch die Prämienlast. Die Frage drängt sich deshalb auf, ob da über Generationen hinweg etwas schiefgelaufen ist. «Zwar ist die Kostensteigerung im Gesundheitswesen in der Tat überproportional», sagt dazu Beatrix Eugster (siehe Kasten), «aber schiefgelaufen ist grundsätzlich nichts. Vielmehr war und ist der Kostenanstieg ein direktes Abbild der jeweiligen Entwicklungen und lässt sich meist gut erklären.» Zu Zeiten von Josef Bruggmann waren es vor allem grosse Krankheitsausbrüche, etwa im Zuge der grassierenden Tuberkulose oder der Spanischen Grippe, welche die Krankenversicherungen enorm belasteten. «Heute sind es in erster Linie die alternde Gesellschaft sowie der rasche medizinische Fortschritt, die zu Buche schlagen.»
Nicht bloss auf die Kosten zeigen
Vor diesem Hintergrund dürfe man den Finger nicht einzig auf die Kostenseite legen. «Vielmehr müssen wir auch stets den Nutzen sehen», so Beatrix Eugster, «zum Beispiel den Umstand, dass wir heute diverse Krankheiten heilen oder zumindest hinauszögern können.» Beides helfe unter dem Strich letztlich mit, auch Kosten einzusparen. Gleichwohl müsse alles unternommen werden, um das Gesundheitswesen auch in Zukunft in einem zahlbaren Rahmen zu halten. Dazu gebe es verschiedene Interventionsmöglichkeiten. «Viele davon sind seit Jahren durchaus bekannt», so Beatrix Eugster. Dazu zählt zum Beispiel das elektronische Patientendossier, das viele Leerläufe und damit unnötige Kosten verhindern könnte. «Aber auch bei der Digitalisierung sehe ich ein enormes Effizienzpotenzial.» Sie erwähnt in diesem Zusammenhang die Corona-Pandemie, während der die Infektionsmeldungen nicht elektronisch, sondern – wie vor Jahrzehnten – per Fax ausgetauscht wurden. Weitere grosse Effizienzsteigerungen lägen in der Einschränkung der Medikamentenabgabe durch die Ärzteschaft und vor allem einer durchdachten Planung der Schweizer Spitallandschaft, die noch immer sehr föderal geprägt sei. «Zudem müssen wir die Systematik hinterfragen, dass ein Arzt, eine Ärztin oder ein Spital umso mehr verdient, je mehr Leistungen verschrieben werden.»
«Der Staat sollte Innovationen nicht durch neue Regulatorien verhindern.»
Der Hang zum Status quo
Doch weshalb tut sich die Schweiz dermassen schwer, längst bekannte Probleme zu lösen? Dazu Beatrix Eugster: «Der Hauptgrund liegt im typisch schweizerischen Konsenswillen, gekoppelt mit einem ausgeprägten Hang zum Status quo.» Das führe zur paradoxen Situation, dass man zwar gewillt sei, Probleme gemeinsam anzupacken. Vor lauter Konsens liege dann aber – nach oft langwierigen Verhandlungen – nicht selten ein Vorschlag auf dem Tisch, der nicht günstiger, sondern teurer sei. «Und wenn bei der Spitalplanung die Verhandlungspartner nicht exakt wissen, was eine Zusammenlegung zweier Kliniken oder gar eine Spitalschliessung bringen könnte, so lassen sie es lieber sein. Und alles bleibt vorderhand beim Alten.»
Brechstange bringt nichts
Statt mit der Brechstange neue Lösungen erzwingen zu wollen, sei es sinnvoller, unter anderem im Bereich der Krankenversicherung die staatlichen Zügel zu lockern und Innovationen nicht durch neue Regulatorien zu verhindern. «Denn oft sind es die Versicherer selber, die gewillt sind, neue Ideen und Ansätze zu generieren, wie es zum Beispiel die CSS mit ihrem Health Lab und der Forschung nach neuen Therapieansätzen tut.» Als Beispiel negativer staatlicher Intervention nennt sie das Schicksal der Initiative der CSS, die vor einigen Jahren Versicherte mit bestimmten Krankheiten anschrieb, um sie für die Verwendung von Generika statt teurer Originalpräparate zu sensibilisieren. Statt die Idee, die zu Kosteneinsparungen geführt hätte, zu unterstützen, wurde sie vom Bund aus Datenschutzgründen kurzerhand verboten. Denkbar sei auch der Ansatz, gesundheitsfördernde Aktivitäten nicht bloss in der Zusatzversicherung, sondern auch – was derzeit untersagt ist – in der Grundversicherung mit einer gewissen Prämienreduktion zu belohnen. «Es muss bei Behörden und in der Politik endlich ankommen, dass man Versicherer durchaus machen lassen darf, wenn es um einfache, aber sinnvolle Massnahmen geht.»
Beatrix Eugster
Beatrix Eugster (Jahrgang 1983) ist Professorin für Volkswirtschaftslehre am Schweizerischen Institut für Empirische Wirtschaftsforschung der Universität St. Gallen. Sie lehrt unter anderem in den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsmarktökonomie und ist Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie. Beatrix Eugster ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Gesellschaftspolitische Frage
In welche Richtung sich das Schweizer Gesundheitswesen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten genau entwickeln wird, ist für Beatrix Eugster offen. Tatsache sei, dass Radikallösungen wie etwa eine Minimalversicherung oder gar die Aufhebung des Versicherungsobligatoriums keine wirklich valablen Alternativen seien, würden doch damit die Kosten nicht verhindert, sondern bloss verlagert. Vielmehr gehe sie davon aus, dass mittelfristig weiterhin die gut schweizerische Verhandlungstugend etwas bewirken werde. «Der Wille, etwas zu verändern, war schon immer vorhanden und hat kontinuierlich zu neuen Lösungen und Veränderungen geführt; langsam zwar, aber stetig.» Wie zum Beispiel beim Thema «Managed Care», wo heute zahlreiche sinnvolle Angebote auf dem Markt seien, aus denen die Versicherten wählen und sich so selber einschränken könnten. Allerdings sei es blauäugig, an eine kostenmässige Trendwende zu glauben. «Denn der Gesundheitsmarkt ist nicht mehr wie in den Anfängen ein wohltätiges Unterfangen. Vielmehr ist er – wie es das Wort schon sagt – ein Business. Und das wird auch so bleiben.» Letztlich sei es deshalb eine gesellschaftspolitische Frage, wie stark man die medizinischen Möglichkeiten ausreizen wolle, ohne gleichzeitig die durchaus sinnvolle Solidarität unter den Versicherten zu opfern.